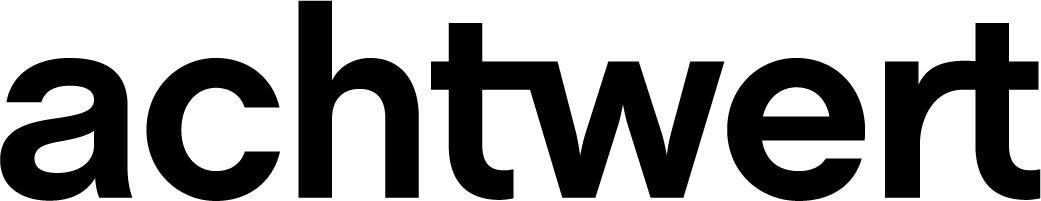Im Kontext von Leadership wird häufig der Fokus auf mangelhafte Führungskompetenzen gelegt. Zahlreiche wissenschaftliche Studien, Fachartikel und Erfahrungsberichte beleuchten Aspekte wie unangemessenes Verhalten, unzureichende Kommunikation oder Defizite im Kompetenzbereich von Führungskräften. Eine zentrale Fragestellung bleibt dabei jedoch oftmals unbeachtet: Liegt die Verantwortung für die Qualität von Führung ausschließlich bei den Führungskräften oder beeinflusst auch das Verhalten der Mitarbeitenden maßgeblich das Führungsverständnis?
Dominanz des Top-down-Narrativs
In öffentlichen Debatten werden Führungskräfte oftmals als alleinige Verantwortliche für das Teamgeschehen betrachtet. Bleiben Resultate aus, sinkt die Motivation oder verschlechtert sich die Arbeitsatmosphäre, erfolgt die Schuldzuweisung zumeist an die Führungsebene. Diese Sichtweise erscheint insofern nachvollziehbar, als dass die Führungskraft Entscheidungen trifft, die strategische Ausrichtung vorgibt und Rahmenbedingungen definiert. Gleichwohl greift diese Betrachtung zu kurz: Führung ist ein wechselseitiger Beziehungsprozess, der sowohl Einflussnahme als auch Reaktionen einschließt.
Führung als Interaktionsprozess
Eine nachhaltige Führungskultur entsteht nicht isoliert, sondern basiert auf aktiver Interaktion. Selbst eine kompetente und engagierte Führungskraft erzielt nur dann Wirkung, wenn die Mitarbeitenden bereit sind, sich einzubringen. Umgekehrt gilt: Auch die versierteste Führungskraft ist auf regelmäßiges Feedback angewiesen, um blinde Flecken zu erkennen und Fehler zu korrigieren. Ein konstruktiver Dialog sowie die Bereitschaft, Verantwortung wahrzunehmen, bilden die Grundlage für eine gesunde Führungsdynamik.
Praxisbeispiel
Eine Gallup-Umfrage aus dem Jahr 2023 veranschaulicht die Relevanz beider Seiten: Rund 70 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Engagement maßgeblich vom Verhalten der direkten Führungskraft abhängt. Ein Drittel stellte jedoch ebenfalls heraus, dass das eigene Verhalten und die Offenheit gegenüber der Führungskraft einen entscheidenden Beitrag zur Qualität der Zusammenarbeit leisten.
Diese Daten unterstreichen, dass Führung als gemeinsamer Prozess zu betrachten ist und sich Verantwortung nicht ausschließlich an die Hierarchieebene delegieren lässt.
Reflexion der eigenen Rolle
Ein Perspektivwechsel unterstützt die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Position innerhalb des Führungssystems. Mitarbeitende können durch die Reflexion folgender Fragen zur Optimierung der Zusammenarbeit beitragen:
- Unterstütze ich die Ziele und Bemühungen meiner Führungskraft?
- Spreche ich Herausforderungen offen an oder überlasse ich deren Lösung anderen?
- Trage ich durch konstruktives Feedback zu einem kooperativen Arbeitsklima bei?
Kooperation basiert grundsätzlich auf Gegenseitigkeit; dies gilt auch für die Führungsbeziehung.
Führungskräfte im Spannungsfeld der Erwartungen
Führungskräfte sehen sich vielfach hohen Anforderungen ausgesetzt: Neben Ergebnisverantwortung und Erwartungsmanagement umfasst ihr Aufgabenfeld die Entwicklung und Motivation ihrer Teams. Dabei wird häufig übersehen, dass auch Führungskräfte menschliche Eigenschaften wie Stärken, Schwächen und Unsicherheiten besitzen. Ein unterstützendes und kommunikationsförderndes Arbeitsumfeld kann dazu beitragen, Führungskräfte zu entlasten und gleichzeitig die Eigenverantwortung der Teams zu fördern.
Konstruktives Mitarbeiterengagement
Mitarbeitende beeinflussen wesentlich, ob Führungsprozesse erfolgreich verlaufen. Dafür tragen insbesondere folgende Faktoren bei:
- Selbstreflexion: Bewusstes Wahrnehmen der eigenen Rolle und der damit verbundenen Erwartungen.
- Offene Kommunikation: Proaktive Thematisierung von Problemen, bevor diese eskalieren, unter Wahrung einer lösungsorientierten Haltung.
- Konstruktives Feedback: Rückmeldungen, die Wertschätzung ausdrücken und zugleich Entwicklungsfelder benennen.
- Übernahme von Verantwortung: Eigeninitiative zeigen und nicht sämtliche Aufgaben an die Führungskraft delegieren.
Durch die Berücksichtigung dieser Aspekte kann sich die Zusammenarbeit zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden nachhaltig verbessern.
Entwicklungspotentiale in Unternehmen
Organisationen profitieren davon, nicht ausschließlich in die Weiterentwicklung von Führungskräften zu investieren, sondern auch Programme zur Förderung der Mitarbeitenden anzubieten – beispielsweise in den Bereichen Feedbackkultur, Kommunikation und Selbstorganisation. Solche Initiativen stärken das gemeinsame Führungsverständnis und fördern eine Arbeitskultur, in der Verantwortung geteilt wird.
Wertschätzung als Leitmotiv
In einer von Komplexität und Veränderung geprägten Arbeitswelt empfiehlt es sich, Schuldzuweisungen zugunsten partnerschaftlicher Lösungsfindung zu vermeiden. Eine wertschätzende Unternehmenskultur zeichnet sich dadurch aus, Verantwortung gemeinsam zu übernehmen und Führung als geteilte Aufgabe zu begreifen.
Fazit
Schlechte Führung resultiert selten ausschließlich aus individuellem Fehlverhalten der Führungskraft, sondern ergibt sich häufig aus einer gestörten Interaktion zwischen Führung und Team. Erfolgreiche Führung gelingt dann, wenn beide Seiten Verantwortung übernehmen: Führungskräfte bieten Orientierung und schaffen Vertrauen, während Mitarbeitende sich aktiv einbringen, Feedback geben und ihre Rolle bewusst gestalten. Anstatt Schuld zuzuschreiben, sollte die partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Fokus rücken.